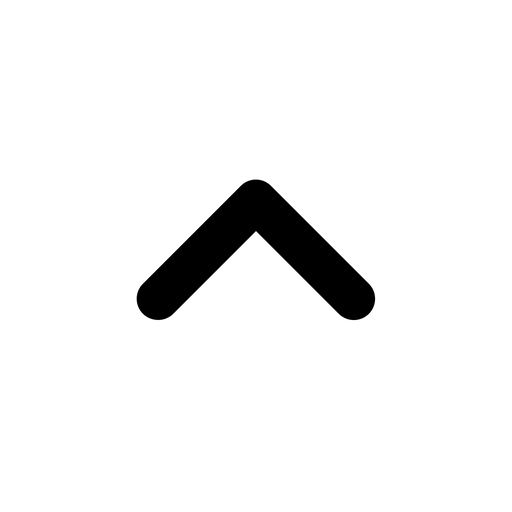Auf die Stromnetze kommen große Herausforderungen zu: Im Zuge der Energiewende werden vor allem Kohle und Öl durch regenerativ erzeugten Strom substituiert. Energie, die heute über Straßen, Schienen oder Wasserwege rollt, wird künftig durch die Netze fließen. Dabei müssten die Stromnetze schon ohne die Substitution von fossilen Energieträgern mehr elektrische Energie transportieren, denn der Bedarf wächst kontinuierlich.
-
Impulse
- Impulse Übersicht
-
Transformatorhersteller
- Südamerikas Champions der Energiewende
- Traktions-Transformatoren – Zukunft auf der Schiene
- Zeit der Giganten: XXL-Trafos für mehr Strom
- „Reinhausen ist lieferfähig!“
- Umsteller mit Übergröße
- Die weltweit leistungsstärksten Trafos für 1.100-kV-HGÜ-Leitung in China
- „Mit dem RONT befinden wir uns in einem Wachstumsmarkt“
- Digitalisierungswende: GANZ Intelligent Solutions setzt auf Kooperation mit MR
- „Im Wandel zum Lösungsanbieter liegt eine große Chance für Trafohersteller – die Digitalisierung hilft dabei!“
-
Digitalisierung
- Wenn die KI mitdenkt
- myReinhausen: Die zentrale digitale Kundenplattform von MR
- Warum Datacenter niemals ausfallen (dürfen)
- Automatisierung? Aber (cyber-)sicher!
- Weltweit einzigartig: Luftentfeuchter MESSKO® MTRAB® kommuniziert via Handy-App
- Remote Solutions: Profi-Hilfe aus der Ferne
- „Die Digitalisierung der Stromnetze funktioniert nur mit umfassenden Sicherheitsmaßnahmen“
- Warum digitalisieren Sie Ihre Transformatoren? Drei Fragen an Rúnar Svavar Svavarsson.
- 6 Herausforderungen, 6 Lösungen – Intelligente Sensoren für zuverlässige Trafos
-
Energiewende
- Der rONT ist das perfekte Betriebsmittel, um die Spannungsprobleme in unserem Verteilnetz zu lösen
- So werden Trafos nachhaltiger
- 940 Tonnen Stromverteiler
- Sonnige Aussichten: kommunale Solarspeicher
- Vier Gründe, warum geregelte Verteilnetze die Zukunft sind
- „Die Energiewende findet in den Verteilnetzen statt“
- Fünf Thesen zur Zukunft der Stromnetze
- Speichern auf allen Netzebenen
- Prüfsysteme für die Energiewende
- Klimawandel, Energiewende und die Zukunft der Stromnetze?
- Neues Design für Strommasten
-
Wind- und Sonnenenergie
- Die Nordsee als grünes Kraftwerk Europas
- Sicherer Sahara-Strom für die Insel
- Sind Windparks die neuen Kraftwerke?
- Gleichstrom auf allen Netzebenen
- Die MSCDN-Anlage – der neue „Kraftwerksgenerator“ für stabile Netze
- Sauberes Stromnetz mit Hochfrequenz-Filtern
- Wetterfeste Kabelprüfung für Offshore-Windparks
- RONTs für Australiens Verteilnetze
- Lebensdaueroptimierung
-
Stromversorgung in der Industrie
- Mehr Strom für Phoenix
- Das Beste aus grünem Wasserstoff herausholen – mit bewährten MR Lösungen
- Abwasser erzeugt Energie
- Der regelbare Ortsnetztrafo ist die Waffe der asiatischen Industrie im Kampf gegen schwankende Netze
- Schluss mit den Oberschwingungen in der Industrie
- Elektronik in der Schifffahrt: immer saubere Netze
- Globalisierung
- Impulse Übersicht
-
Transformatorhersteller
- Südamerikas Champions der Energiewende
- Traktions-Transformatoren – Zukunft auf der Schiene
- Zeit der Giganten: XXL-Trafos für mehr Strom
- „Reinhausen ist lieferfähig!“
- Umsteller mit Übergröße
- Die weltweit leistungsstärksten Trafos für 1.100-kV-HGÜ-Leitung in China
- „Mit dem RONT befinden wir uns in einem Wachstumsmarkt“
- Digitalisierungswende: GANZ Intelligent Solutions setzt auf Kooperation mit MR
- „Im Wandel zum Lösungsanbieter liegt eine große Chance für Trafohersteller – die Digitalisierung hilft dabei!“
-
Digitalisierung
- Wenn die KI mitdenkt
- myReinhausen: Die zentrale digitale Kundenplattform von MR
- Warum Datacenter niemals ausfallen (dürfen)
- Automatisierung? Aber (cyber-)sicher!
- Weltweit einzigartig: Luftentfeuchter MESSKO® MTRAB® kommuniziert via Handy-App
- Remote Solutions: Profi-Hilfe aus der Ferne
- „Die Digitalisierung der Stromnetze funktioniert nur mit umfassenden Sicherheitsmaßnahmen“
- Warum digitalisieren Sie Ihre Transformatoren? Drei Fragen an Rúnar Svavar Svavarsson.
- 6 Herausforderungen, 6 Lösungen – Intelligente Sensoren für zuverlässige Trafos
-
Energiewende
- Der rONT ist das perfekte Betriebsmittel, um die Spannungsprobleme in unserem Verteilnetz zu lösen
- So werden Trafos nachhaltiger
- 940 Tonnen Stromverteiler
- Sonnige Aussichten: kommunale Solarspeicher
- Vier Gründe, warum geregelte Verteilnetze die Zukunft sind
- „Die Energiewende findet in den Verteilnetzen statt“
- Fünf Thesen zur Zukunft der Stromnetze
- Speichern auf allen Netzebenen
- Prüfsysteme für die Energiewende
- Klimawandel, Energiewende und die Zukunft der Stromnetze?
- Neues Design für Strommasten
-
Wind- und Sonnenenergie
- Die Nordsee als grünes Kraftwerk Europas
- Sicherer Sahara-Strom für die Insel
- Sind Windparks die neuen Kraftwerke?
- Gleichstrom auf allen Netzebenen
- Die MSCDN-Anlage – der neue „Kraftwerksgenerator“ für stabile Netze
- Sauberes Stromnetz mit Hochfrequenz-Filtern
- Wetterfeste Kabelprüfung für Offshore-Windparks
- RONTs für Australiens Verteilnetze
-
Lebensdaueroptimierung
-
Stromversorgung in der Industrie
- Mehr Strom für Phoenix
- Das Beste aus grünem Wasserstoff herausholen – mit bewährten MR Lösungen
- Abwasser erzeugt Energie
- Der regelbare Ortsnetztrafo ist die Waffe der asiatischen Industrie im Kampf gegen schwankende Netze
- Schluss mit den Oberschwingungen in der Industrie
- Elektronik in der Schifffahrt: immer saubere Netze
-
Globalisierung
Impulse - Portfolio
-
Karriere
Karriere
-
Unternehmen
Unternehmen
Klimawandel, Energiewende und die Zukunft der Stromnetze?
Nur mit der Energiewende ist der Klimawandel noch zu bremsen. Die Folge: 2040 müssen die Netze bis zu 50 Prozent mehr Strom transportieren.
Klimawandel, Energiewende und die Zukunft der Stromnetze?
Nur mit der Energiewende ist der Klimawandel noch zu bremsen. Die Folge: 2040 müssen die Netze bis zu 50 Prozent mehr Strom transportieren.
Fachleute sind sich einig: Der Anteil der Großkraftwerke in den Stromnetzen (Kernkraft, Kohle und Gas) wird sich im Zuge der Energiewende in den nächsten zwei Jahrzehnten um bis zu 50 Prozent reduzieren. Das heißt, je nach Szenario werden bis zu 79 Prozent der elektrischen Energie emissionsfrei produziert. Solar- und Windstrom haben dabei den größten Anteil. Doch die Produktion erneuerbarer Erzeuger schwankt, zudem sind viele der Anlagen deutlich kleiner als konventionelle Kraftwerke und auch auf Nachfragerseite werden vor allem durch die Elektromobilität Schwankungen zunehmen. Der Umstieg auf erneuerbare Energie wird deshalb drastische Auswirkungen auf die Stromnetze haben. Netzplaner und -betreiber stehen deshalb vor fünf zentralen Fragen:
1 Wie wird die Leistung in zunehmend volatilen Stromnetzen geregelt?
Die Betriebsführung der Netze muss sich einem schwankenden Angebot an elektrischer Energie anpassen. Wo früher der Kohlebunker als Speicher diente, sind nun neue Methoden gefragt. Zu den künftig wichtigsten Speichertechnologien zählen Power-to-Gas-Anlagen, Pumpspeicherkraftwerke oder Batterien.
2 Was bedeutet die Energiewende für die Struktur der Stromnetze?
2 Was bedeutet die Energiewende für die Struktur der Stromnetze?
Erneuerbare Erzeuger werden überwiegend dort errichtet, wo das Angebot an Primärenergie (Wind, Sonne, Biogas, Biomasse) am größten ist, nicht zwangsläufig am Ort der größten Nachfrage. Die Anlagen werden tendenziell kleiner, Erzeuger verlagern sich in die Verteilnetze. Ein Ausbau der Verteilnetze und Übertragungsnetze wird damit in vielen Fällen erforderlich.
3 Müssen die Stromnetze wachsen?
Im Zuge der Energiewende müssen die Netze bald 50 Prozent mehr elektrische Energie transportieren. Die Betriebszeiten von Windanlagen liegen bei rund 40 Prozent und die von Solaranlagen bei knapp 15 Prozent. Um die gleich Energiemenge wie mit konventionellen Anlagen zu erbringen, müssen also wesentliche höhere Kapazitäten aufgebaut werden. Die Integration des Straßenverkehrs ins Stromnetz bringt zudem nachfrageseitig neue Schwankungen ins Netz. Je nach Reservekapazität der Netze ist ein Ausbau erforderlich.
4 Wie werden Stromnetze flexibler?
4 Wie werden Stromnetze flexibler?
Stromnetze verfügen über eine Reserve für Ausnahmesituationen sowie für den sicheren Betrieb im Fehlerfall. Transport von mehr Strom bei höheren Schwankungen auf Angebots- und Nachfrageseite führt zu einer stärkeren Auslastung der Netze auf allen Spannungsebenen. Smart Grids, Smart Meter, neue Konzepte an den Regelbörsen und flexiblere Preismodelle helfen bei der dringend notwendigen Flexibilisierung.
5 Welche Technologien braucht es für den Ausbau der Netze?
Windanlagen, Solaranlagen, elektrische Speicher, Elektrolyseanlagen, Ladeinfrastruktur für elektrische Fahrzeuge, sowie viele weitere Verbraucher haben eines gemeinsam: Sie werden mit Gleichstrom betrieben, beziehungsweise liefern Gleichstrom. Der Einsatz leistungselektronischer Umrichter wird künftig zunehmen. Weiterhin ist eine zunehmende Automatisierung der Netze absehbar. Die Anforderungen bleiben hierbei gleich: Der sichere Betrieb der Netze mit hoher Stromqualität und Spannungsqualität.
Mehr über die Zukunft der Netze finden Sie in unserem Magazin ONLOAD
Rund 17 Prozent des weltweiten Energiebedarfs fließen heute als elektrische Energie durch die Netze. Der Anteil wächst, denn künftig fließt hier auch Energie, die heute noch in Motoren verbrannt wird. Was bedeutet das für die Netze von morgen?
Erneuerbare Energien sind volatil. Ohne Speichertechnologien über alle Netzebenen hinweg wird es keine Dekarbonisierung geben. Innovative Speichersysteme sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg in die Zukunft.
Wir sind für Sie da. Und dort.
Auf der Suche nach dem richtigen Ansprechpartner?
Sie haben ein Anliegen, aber wissen nicht, an wen Sie sich wenden sollen? In unserer Kontaktübersicht werden Sie fündig. Im Falle einer technischen Betriebsstörung steht Ihnen unser 24/7 Support jederzeit zur Verfügung.
Willkommen bei myReinhausen
myReinhausen ist die zentrale, digitale Kundenplattform der MR. Kunden erhalten auf myReinhausen Zugang zu kundenspezifischen MR Informationen, sowie zu zahlreichen kostenlosen Funktionen rund um das MR Portfolio.
myReinhausenWerden Sie Teil der Reinhausen Familie
Schnell zum passenden Job!
Entdecken Sie unsere offenen Stellen. Bewerben Sie sich noch heute und tragen Sie beim Weltmarktführer in der Energietechnik dazu bei, die Energieversorgung auch in Zukunft stabil zu halten.